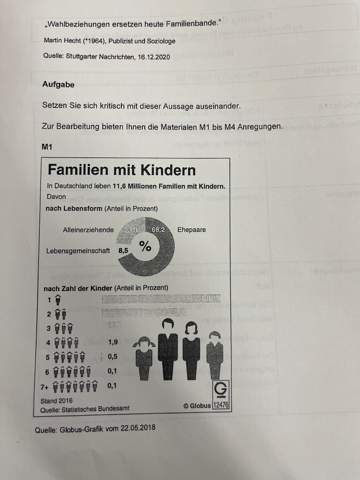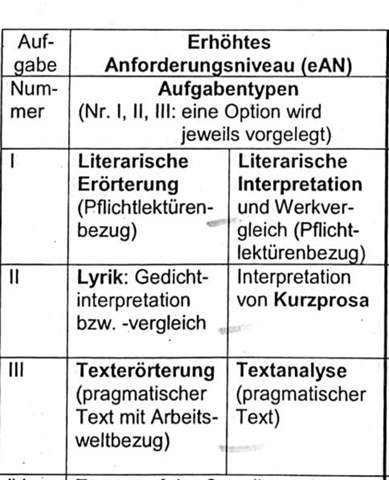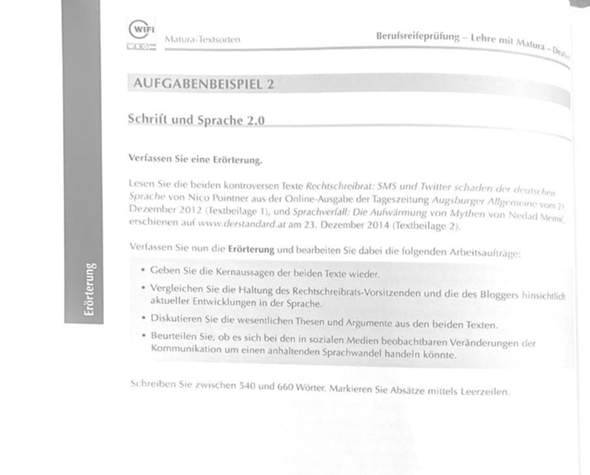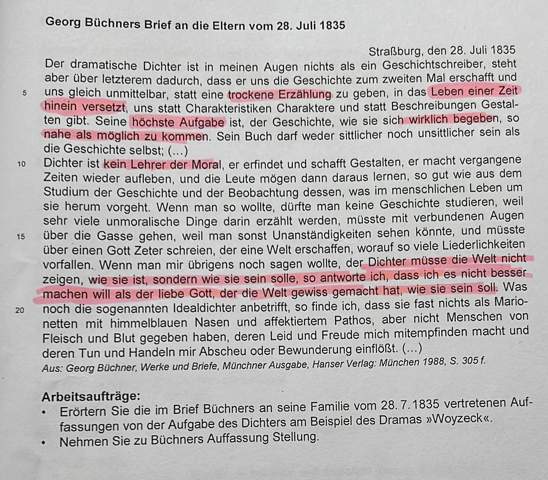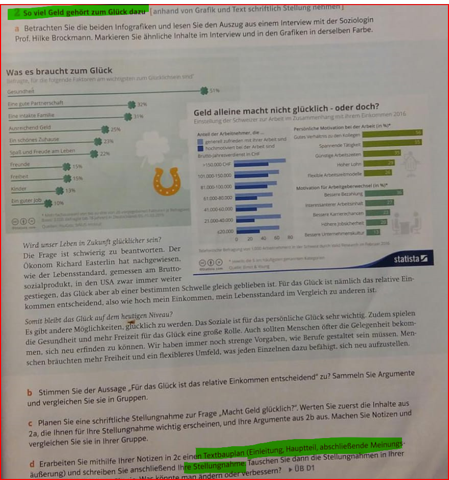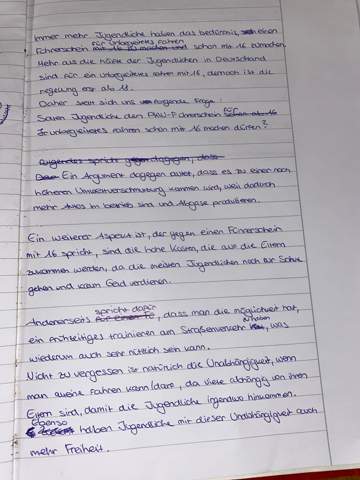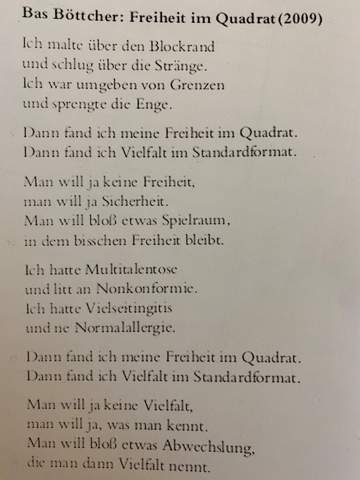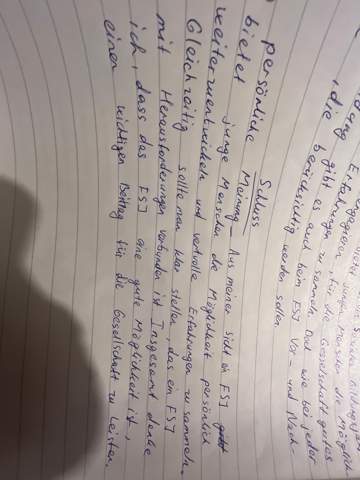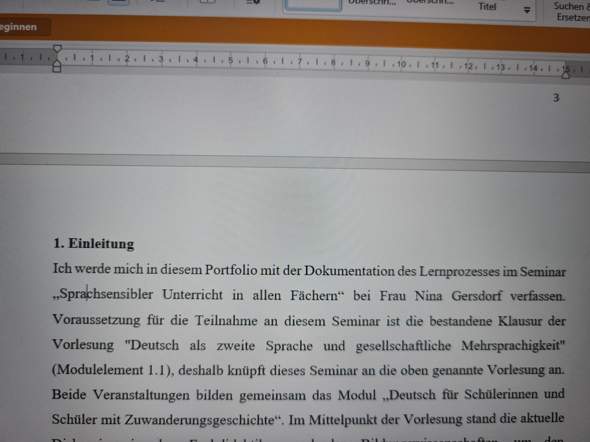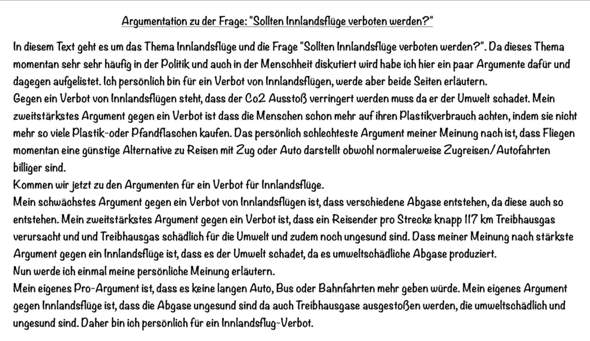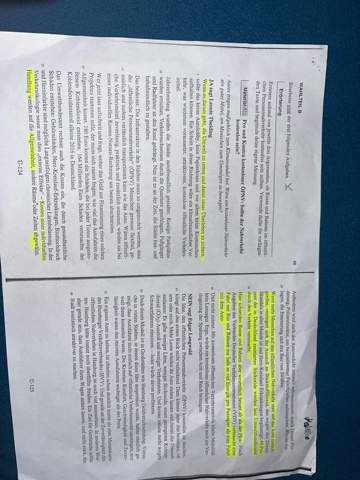Ich brauche Rückmeldung zu dem Hauptteil meiner dialektischen Erörterung zur Fragestellung: wäre die Einführung der Zuckersteuer in Deutschland sinnvoll?
Zunächst ist anzuführen, dass es einige Argumente gibt, die dafür sprechen, dass die Einführung einer Zuckersteuer sinnvoll wäre.
Ein immer wieder vorgebrachtes Argument der Befürworter ist hierbei, dass der Staat versuchen muss vor allem Kinder vor Übergewicht zu schützen, da es die Aufgabe des Staats ist, alles was für den Menschen schädlich sein kann, von ihm fernzuhalten. Laut der AZ-Agentur nahmen in England die Menschen durch die Zuckersteuer durchschnittlich 500 Kalorien weniger zu sich.
Außerdem werden Menschen immer übergewichtiger, da es ein überreichliches Angebot an ungesunden Produkten gibt, wie zum Beispiel Nutella, Pizza etc., weshalb der Staat versuchen muss diese steigende Zahl in Form einer Zuckersteuer zu bremsen.
Weiterhin ist zu bedenken, dass Behandlungen in Zusammenhang mit Übergewicht teuer sein können, da sie oft komplexe Behandlungen nach sich ziehen und dies somit zum Beispiel für Krankenkassen sehr teuer sein kann. In England musste man bereits 10 Millionen Euro ausgeben für Behandlungen mit Übergewicht.
Neben diesen Argumenten, die dafür sprechen, dass die Einführung einer Zuckersteuer sinnvoll wäre, sind auch folgende Aspekte zu berücksichtigen, die dafür sprechen, dass die Einführung der Zuckersteuer in Deutschland nicht sinnvoll wäre.
Manche Menschen verfügen nicht über die Ressourcen, sich eine Zuckersteuer zu leisten, da sie oftmals nur über ein geringes Einkommen verfügen, wodurch sie sich nicht die teueren gesunden Produkte leisten können, sondern nur die meist billigen ungesunden Produkte leisten können. Wird nun eine Zuckersteuer eingeführt, können sich manche Menschen nun auch die ungesunden Produkte nicht mehr leisten, wodurch es passieren könnte, dass sie sich nicht mehr selbst ernähren können.
Ein weiterer Aspekt, der in diesem Themenkomplex zu berücksichtigen ist, ist dass die Zuckersteuer fälschlich den Eindruck vermitteln würde, dass nur ein Produkt zu Übergewicht führt, allerdings gibt es andere Produkte die ebenfalls übergewichtig machen. Darüberhinaus kommt es vielmehr auf eine ausgewogene Ernährung an. Führt die Zuckersteuer nämlich dazu, dass mehr Fruchtsäfte gekauft werden ist das Ziel der Steuer verfehlt, da die Kaloriengehälter identisch sind mit normalen Softdrinks.
Von außerordentlicher Wichtigkeit erscheint mir der Aspekt, dass jeder selbst entscheiden soll, was er trinken und essen möchte, da es eine ausreichendes Angebot von ungesunden und gesunden Produkten gibt und dadurch jeder selbst entscheiden kann was er zu sich nimmt. Der Generalsekretär der FDP sagt, dass man die Menschen nicht bevormunden solle, sondern auf die Kompetenz des Menschen setzen solle eine eigene Entscheidung zu treffen.
ich bitte um schnelle Rückmeldung
bitte nicht auf Rechtschreibung achten.
.