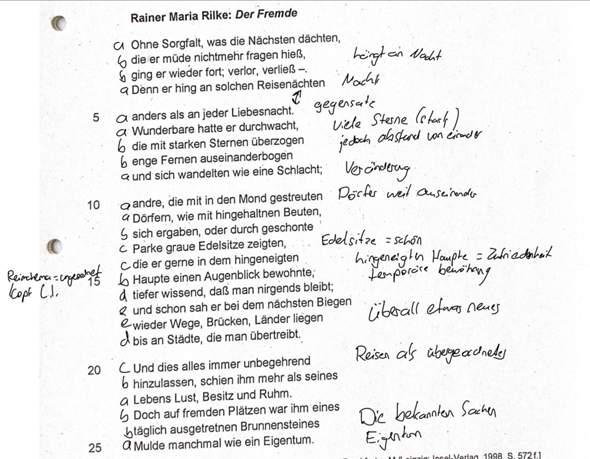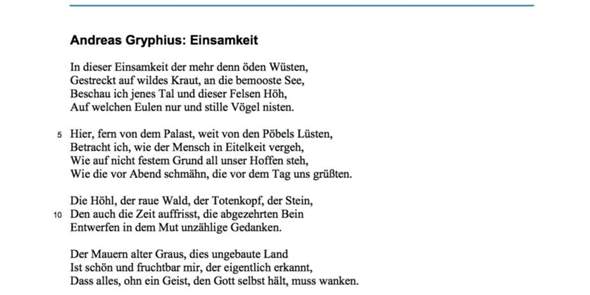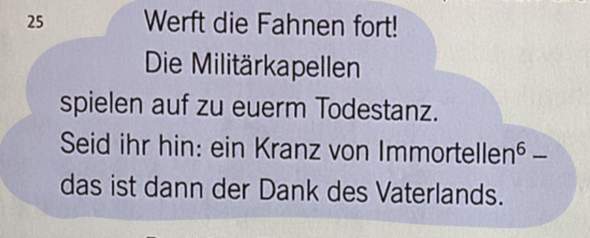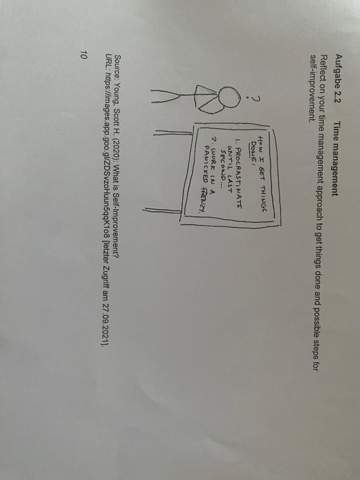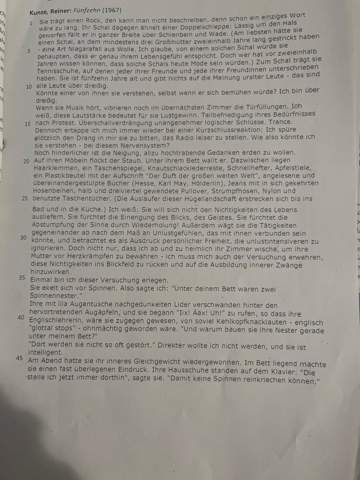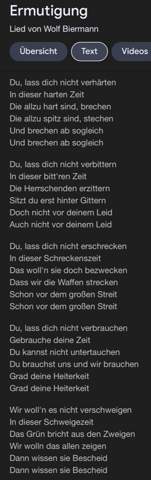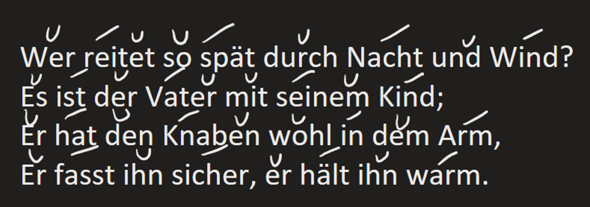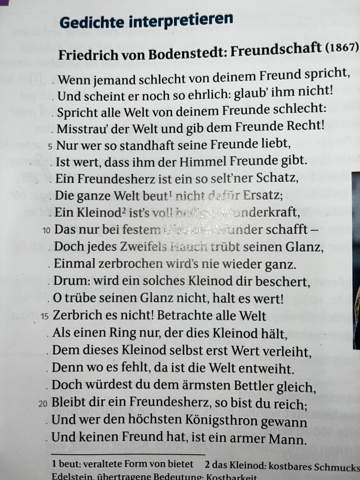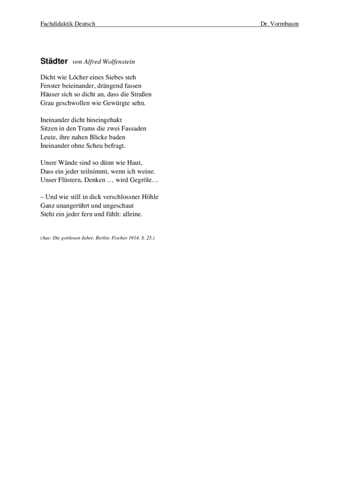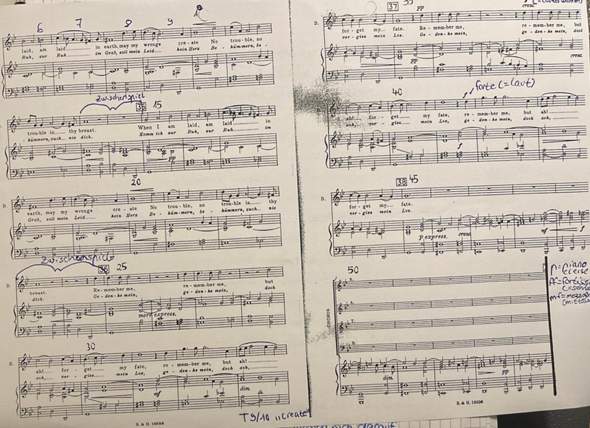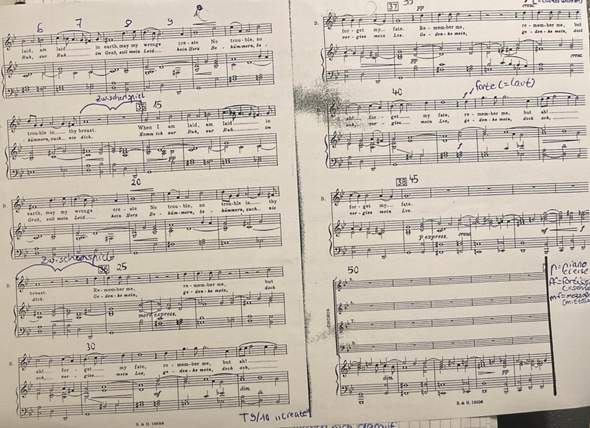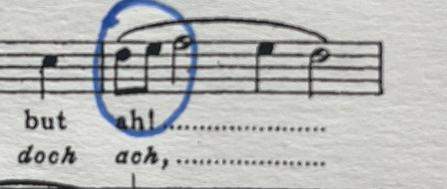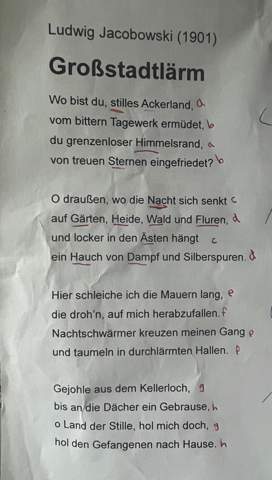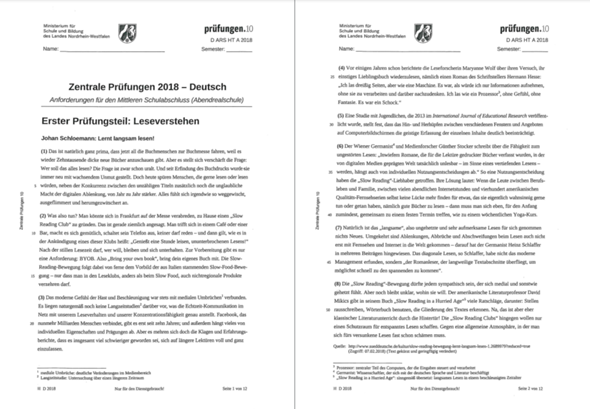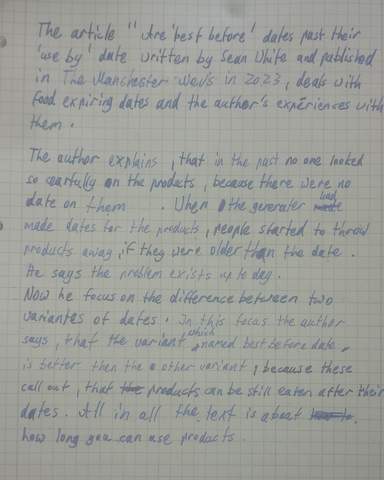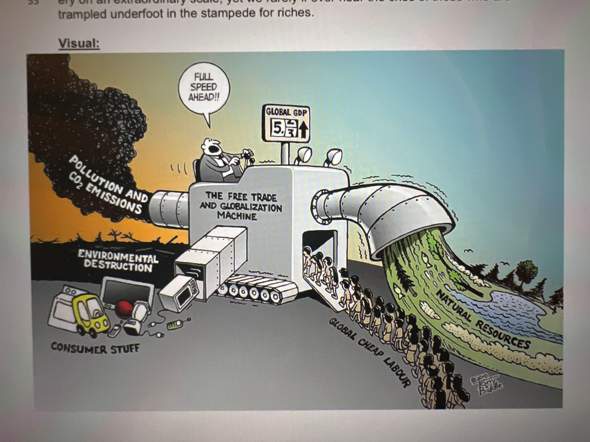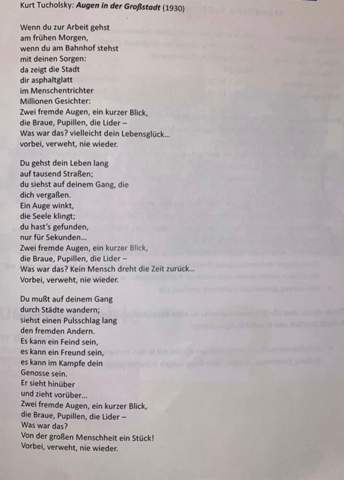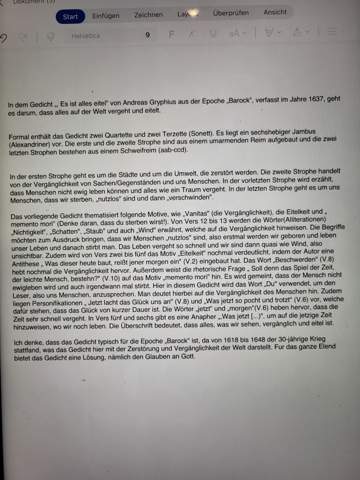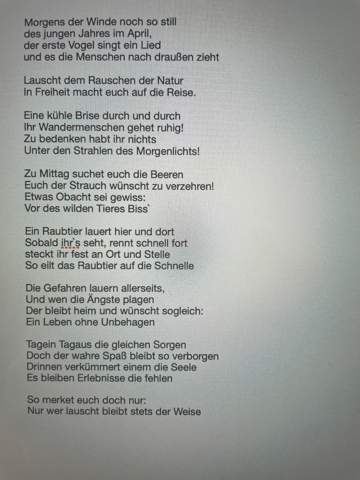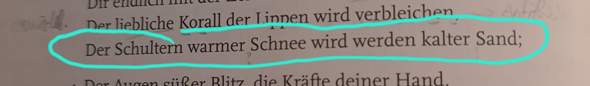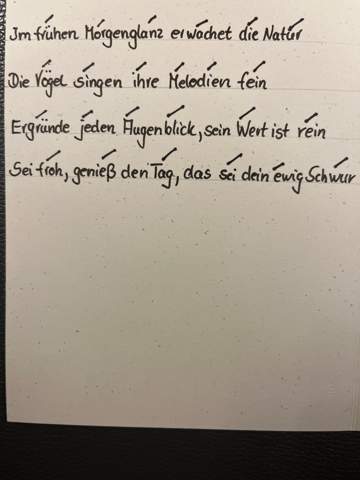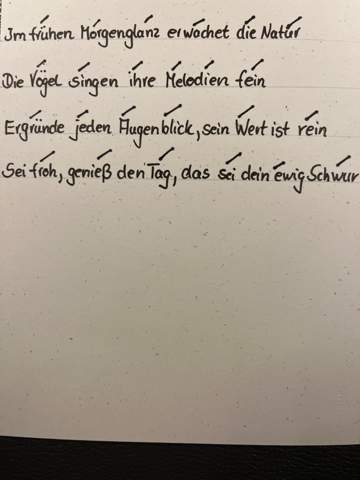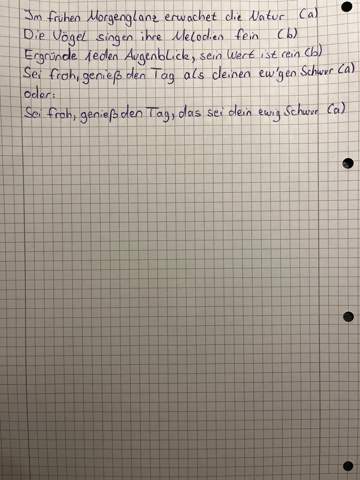Hey Leute,
das ist eine Frage für Grammatiknerds. Ich habe mich bisher immer selbst als einer gesehen, aber jetzt bin ich gerade so verwirrt...
Es geht um meine Masterarbeit. Einige Kapitel bestehen aus Zeitungsanalysen. Mir ist in der Theorie völlig klar, welche Zeitform wann eingesetzt werden muss: Für eine Zusammenfassung und Analyse der Inhalte von Artikeln verwendet man das Präsens, für eine Schilderung der historischen Ereignisse eine Vergangenheitsform. Dann kommt aber auch noch das historische Präsens hinzu, durch das der Text zum Teil flüssiger klingt.
Der langen Rede kurzer Sinn: In der Praxis scheint mein Bauchgefühl manchmal inkonsequent zu sein. Wenn ich aber versuche, die Inkonsequenzen zu beheben, klingen die Sätze für mich plötzlich falsch.
Hier sind ein paar Beispiele für Abschnitte, bei denen ich mir unsicher bin:
"Zur selben Zeit nehmen die Erwähnungen Mendelssohns im Allgemeinen stark ab. Im August findet sich in der oben bereits zitierten Zeitung ... eine kurze Werbung für ein kostenloses Orgelkonzert:" - nehmen oder nahmen?
"Bis zur Veröffentlichung des nächsten anhand der Quellen nachvollziehbaren hier relevanten Artikel vergeht mehr als ein Jahr: Im März 1944 weist das ... auf eine anstehende kirchliche Veranstaltung hin." - verging oder vergeht?
"Einer weiteren Trauerfeier, in der ein Stück Mendelssohns aufgeführt wurde, widmete ... im Februar 1943 einen Artikel. Unter anderem sei Musik „uit de Elias van Mendelssohn“ erklungen." - widmete oder widmet?
"Wenige Monate später wird das anscheinend bei Beerdigungen beliebte „Beati Mortui“ ein weiteres Mal erwähnt. Beim Begräbnis eines langjährigen und prominenten Mitgliedes habe der ... eben jenes Werk gesungen, berichtet der ..." - wird oder wurde?
"Ende September zählt Lou van Strien verschiedene Musiker auf: ... Auf Salomone Rossi bezogen fügt der Autor hinzu:" - zählt oder zählte?
"Kurze Zeit später sah das schon anders aus; inzwischen war das ... gegründet, das nur noch Musik von Komponisten jüdischer Abstammung spielen durfte. Gleich das erste Konzert war dem ... zufolge vollständig Mendelssohn gewidmet:" - hier ein Absatz, der sich für mich richtig anhört, wenn er komplett im Präsens oder komplett in der Vergangenheit geschrieben ist
"In den folgenden Wochen beschränken sich Erwähnungen Mendelssohns größtenteils auf Konzertprogramme. Eine besondere Ausnahme bildet die Ausgabe des Wochenblattes vom 12. Dezember. Hier findet sich in nicht weniger als fünf Artikeln der Name des Komponisten, wobei drei aus verschiedenen Gründen von besonderer Relevanz sind. In einer Konzertkritik schreibt Lou van Strien etwa über eine Aufführung des ..." - beschränken oder beschränkten?
"Anfang Januar 1942 äußert sich Lou van Strien überschwänglicher als zuvor über Mendelssohn, konkret über dessen Streichoktett:" - äußert oder äußerte?
Ich denke, ihr seht mein Problem. Wann immer ich im selben Satz sowohl das Veröffentlichungsdatum als auch den Inhalt des Artikels erwähne, hört sich für mich das Präsens richtig an. Wenn es nur um die Veröffentlichung oder um die Geschichte geht, hört sich für mich die Vergangenheit richtig an. Und wenn der ganze Absatz im Präsenz steht (s. etwa "In den folgenden Wochen..." und "Zur selben Zeit..."), möchte ich auch im ersten Satz instinktiv das historische Präsens verwenden.
Ist mein Bauchgefühl da auf der richtigen Fährte oder sind da irgendwo grundlegende Fehler?
Danke im Voraus für eure Hilfe.