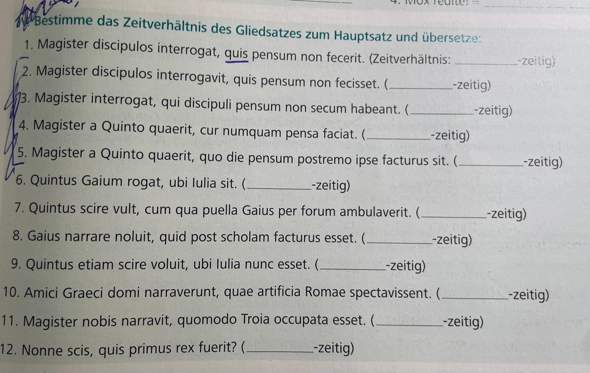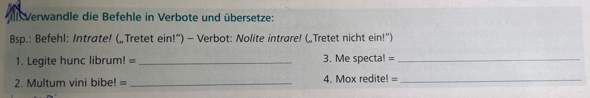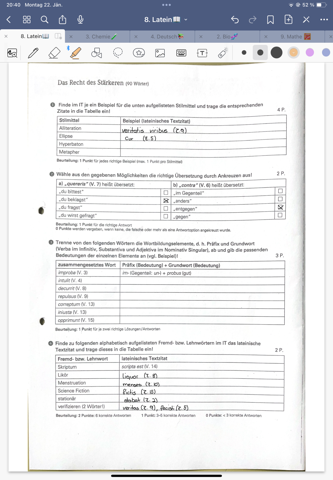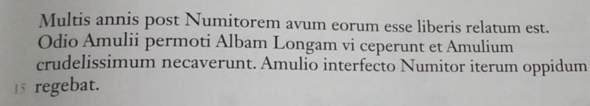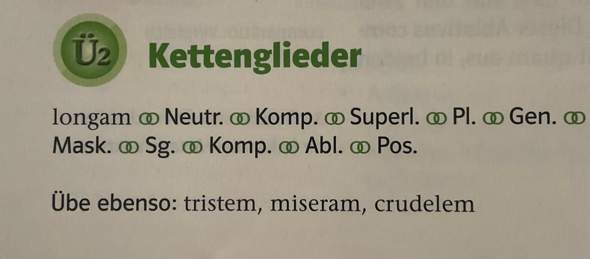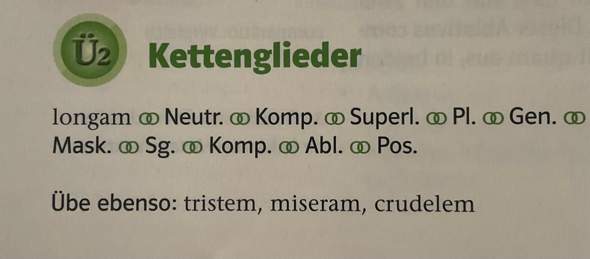Gibt es in dem lateinischen Text noch mehr Stilmittel?
Finde Stilmittel in dem folgenden Text und zitiere die entsprechenden Stellen: Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera potestas, et duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt. Ceterum neque animadvertere neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, non quasi in poenam nec ducis iussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. Effigiesque et signa quaedam detracta lucis in proelium ferunt; quodque praecipuum fortitudinis incitamentum est: non casus, nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et propinquitates; et in proximo pignora, unde feminarum ululatus audiri, unde vagitus infantium. Hi cuique sanctissimi testes, hi maximi laudatores. Ad matres, ad coniuges vulnera ferunt; nec illae numerare aut exigere plagas pavent, cibosque et hortamina pugnantibus gestant. Meine Ausbeute: ⁃ „Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt“ = Parallelismus ⁃ „si prompti, si conspicui, sie ante aciem agant“ = Anapher, Asyndeton ⁃ „ante aciem agant, admiratione“ = Alliteration ⁃ „Hi cuique sanctissimi testes, hi maximi laudatores.“ = Anapher ⁃ „Ad matres, ad coniuges vulnera ferunt“ = Anapher