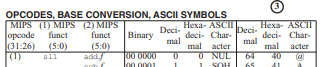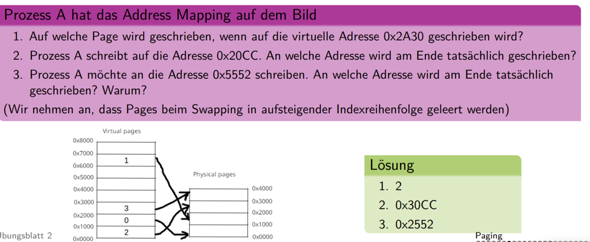C++ Code für LGS?
Ich möchte mit einen C++-Programm alle LGS lösen können (endlich, unendlich und keine Lösungen). Ich habe auch einen Code. Endlich viele und keine Lösungen kann er recht gut (bisher), aber unendlich viele Lösungen kann er nicht anzeigen lassen (soll dann auch t einführen, nicht einfach einen Wert einsetzen). Wo liegt der Fehler? #include <iostream> #include <vector> #include <cmath> using namespace std; // Funktion zur Berechnung des Determinanten einer Matrix double determinant(vector<vector<double>>& matrix, int n) { double det = 0; if (n == 1) { return matrix[0][0]; } if (n == 2) { return matrix[0][0] * matrix[1][1] - matrix[0][1] * matrix[1][0]; } for (int i = 0; i < n; i++) { vector<vector<double>> subMatrix(n - 1, vector<double>(n - 1)); for (int j = 1; j < n; j++) { for (int k = 0; k < n; k++) { if (k < i) { subMatrix[j - 1][k] = matrix[j][k]; } else if (k > i) { subMatrix[j - 1][k - 1] = matrix[j][k]; } } } det += pow(-1, i) * matrix[0][i] * determinant(subMatrix, n - 1); } return det; } // Funktion zur Durchführung der Gauss-Jordan-Elimination void gaussJordan(vector<vector<double>>& matrix, vector<double>& constants) { int n = matrix.size(); for (int i = 0; i < n; i++) { int maxIndex = i; for (int j = i + 1; j < n; j++) { if (abs(matrix[j][i]) > abs(matrix[maxIndex][i])) { maxIndex = j; } } if (maxIndex != i) { swap(matrix[maxIndex], matrix[i]); swap(constants[i], constants[maxIndex]); // Korrektur hier } double factor = matrix[i][i]; for (int j = i; j < n; j++) { matrix[i][j] /= factor; } constants[i] /= factor; for (int j = 0; j < n; j++) { if (j != i) { double factor = matrix[j][i]; for (int k = i; k < n; k++) { matrix[j][k] -= factor * matrix[i][k]; } constants[j] -= factor * constants[i]; } } } } // Funktion zur Überprüfung der Invertierbarkeit und zur Lösung des LGS vector<double> solveLinearSystem(vector<vector<double>>& matrix, vector<double>& constants) { int n = matrix.size(); double det = determinant(matrix, n); // Überprüfung auf unendlich viele Lösungen bool allZero = true; for (double constant : constants) { if (constant != 0) { allZero = false; break; } } if (det == 0) { if (allZero) { cout << "Das LGS hat unendlich viele Lösungen." << endl; return {}; // Leerer Vektor, da unendlich viele Lösungen existieren } else { cout << "Das LGS hat keine Lösung." << endl; return {}; // Leerer Vektor, da keine Lösung existiert } } // Anwendung der Gauss-Jordan-Elimination gaussJordan(matrix, constants); vector<double> solution(n); for (int i = 0; i < n; i++) { solution[i] = constants[i]; } return solution; } int main() { vector<vector<double>> matrix = { { 1, -3, 5 }, { 2, -5, 12 }, { 3, -11, 11 } }; vector<double> constants = { 2, 1, 12 }; vector<double> solution = solveLinearSystem(matrix, constants); if (!solution.empty()) { cout << "Die Lösung des LGS ist: "; for (int i = 0; i < solution.size(); i++) { cout << "x" << i + 1 << " = " << solution[i] << ", "; } cout << endl; } else { cout << "Das LGS hat keine Lösung." << endl; } return 0; }