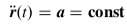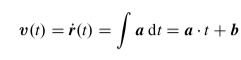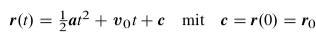Hallo zusammen. Ich hätte mal eine, zugegebenermaßen, ziemlich komisch mathematisch Frage.
Es geht im den Limes. Ich persönlich hatte damit nie viel zu tun und kenne ihn nur vom Differenzieren. Dennoch fand ich diesen "mathematischen Ausdruck" immer recht cool.
Nun stellt sich mir sie Frage, ob man den Limes auch mit in eine Funktion packen darf.
Wäre Folgendes beispielsweise eine korrekte Funktion?
f(x)=lim(n->0)n/x
Das in der Klammer sollte unter dem lim stehen, ich habe gerade nur keine Möglichkeit, dies ordentlich darzustellen.
Das macht im dieser Form wahrscheinlich absolut keinen Sinn, wenn man jedoch andere Funktionen, beispielsweise eine Sinusfunktion, betrachtet kann man damit doch recht hübsche Graphen zaubern.
Nun bin ich eben unentschieden, ob das so zulässig ist, denn zum einen ist es kein mathematischer Ausdruck wie Plus oder Minus, zum anderen beschreibt meine Funktion beispielsweise den Abstand der Funktion f(x)=e^-x zu ihrer Asymptote (zumindest in einem bestimmten Definitionsbereich).
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Antwort hätte und entschuldige mich für diese dumme Frage, die ich dennoch nicht lassen konnte.