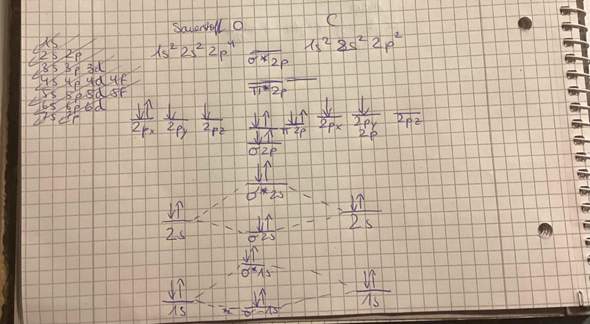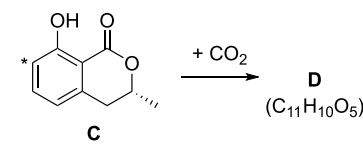Frage zu Plug-Flow-Reaktoren?
Im Grunde möchte ich die Konzentrationsverteilung in einem Plug-Flow-Reaktor (PFR) berechnen. Ich weiß, dass es auf Wikipedia eine vereinfachte Formel gibt, aber ich habe versucht, meinen eigenen Ansatz zu entwickeln, und bin gespannt, ob er funktionieren würde. Ein PFR kann man sich im Wesentlichen als eine extrem lange Kaskade von kontinuierlichen Rührkesselreaktoren (CSTRs) mit infinitesimal kleinen Volumina vorstellen, richtig? Jeder „Plug” hätte eine konstante Konzentration. Für eine Reaktion erster Ordnung in einem CSTR ergibt sich die Konzentration des Reaktanten aus: C(t) = C(0) · exp(-k · t), wobei t die durchschnittliche Verweildauer im Reaktor ist, definiert als das Verhältnis von Volumen zu Volumenstrom. Mein Ansatz wäre, die durchschnittliche Verweildauer für eine sehr kleine Länge (z. B. 1 Millimeter) zu berechnen, sie in die Formel einzusetzen und – da die konstante Konzentration am Auslass eines CSTR zur Einlasskonzentration für den nächsten wird – die Reaktantenkonzentration bei einer bestimmten Länge wie folgt zu beschreiben: C(t) = C(0) · exp(-k · n · t), wobei n die gegebene Länge ist. Dies setzt einen konstanten Volumenstrom und isotherme Bedingungen voraus. Frage: Würde ich ein einigermaßen genaues Ergebnis erhalten, wenn ich dies grafisch darstellen würde?