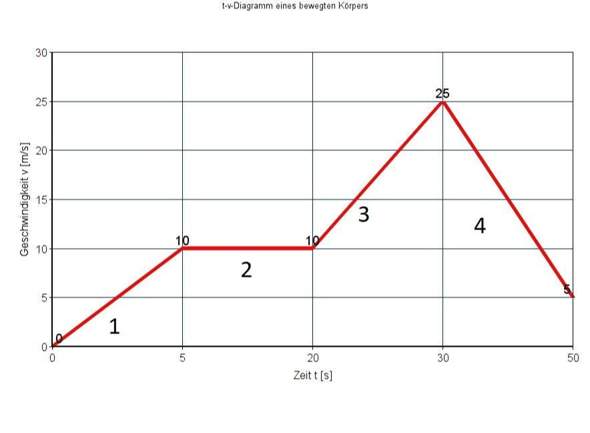Antwort zu Frage 3:
Damit wird eingestellt, ob Wechselspannung/Wechselstrom oder Gleichspannung/Gleichstrom gemessen werden soll.
(Anmerkung: Das Multimeter muss auf den entsprechenden Spannungs- bzw. Stromtyp eingestellt werden, bevor man Messungen in Schaltungen durchführt. Ansonsten kommt es zu fehlerhaften Ergebnissen an der Anzeige.)
Antwort zu Frage 4:
Die (Fein)Sicherungen schützen das Messgerät vor Kurzschluss und Überlast. Damit wird sichergestellt, dass bei fehlerhaften Messungen keine Gerätedefekte entstehen.
Antwort zu Frage 5:
Es gibt analoge und digitale Messgeräte.
Bei analogen Messgeräten folgt die Anzeige des Messwerts stetig der Eingangsgröße (Messgröße). Meist zeigt ein Zeiger oder eine Marke, die gleichmäßig über die Skala geführt wird, den Messwert an.
Analog anzeigende Messgeräte sind Zeigerinstrumente und das Oszilloskop.
Digital anzeigende Messgeräte zeigen den Messwert in Ziffern an. Messwerte können für eine spätere Auswertung auch schriftlich aufgezeichnet werden.
Antwort zu Frage 6:
• Digitale Multimeter haben einen besseren Messbereich als analoge Multimeter.
• Digitale Multimeter bieten zusätzliche Funktionen wie Kapazität, Temperatur, Frequenz, Schallpegelmessung und Erkennung von Halbleiterbausteinpins (Transistor / Diode).
• Analoge Multimeter müssen manuell kalibriert werden, während die meisten Digitalmultimeter vor jeder Messung automatisch kalibriert werden.
• Analogmultimeter müssen manuell für den spezifischen Messbereich eingestellt werden, während einige Digitalmultimeter eine automatische Messfunktion haben müssen.
• Analoge Multimeter erfordern gute Messungen, während digitale Multimeter auch von ungeübten Personen bedient werden können.
• Analoge Multimeter sind weniger teuer, während digitale Multimeter teuer sind.
Antwort zu Frage 7:
Spannungsmessung: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505041.htm
Strommessung: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505051.htm
Widerstandsmessung: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505061.htm
Antwort zu Frage 8:
In einer Reihenschaltung fließt überall derselbe Strom.
Bei einer Reihenschaltung ist die Summe der Teilspannungen an den Verbrauchern so groß wie die angelegte Spannung.
In einer Masche ist die Summe der Erzeugerspannungen (Quellspannungen) und der Teilspannungen an den Verbrauchern null. (Maschensatzregel, 2. kirchhoffsche Regel)
Bei einer Reihenschaltung ist der Gesamtwiderstand gleich der Summe der Einzelwiderstände.
Bei einer Reihenschaltung fällt am größeren Widerstand auch die größere Spannung ab. (Spannungsteilerregel)
Bei einer Reihenschaltung verhalten sich die Spannungen wie die zugehörigen Widerstände.
Antwort zu Frage 9:
An parallel geschalteten Verbrauchern liegt dieselbe Spannung an.
Bei einer Parallelschaltung ist der Gesamtstrom gleich der Summe der Teilströme (Zweigströme).
An jedem Knoten ist die Summe der zufließenden Ströme so groß wie die Summe der abfließenden Ströme. (Knotenpunktregel, 1. kirchhoffsche Regel)
Bei einer Parallelschaltung verhalten sich die Stromstärken umgekehrt wie die zugehörigen Widerstandswerte. Der größere Strom fließt also durch den kleineren (niederohmigeren) Widerstand.
Bei einer Parallelschaltung ist der Ersatzwiderstand stets kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.
Bei der Parallelschaltung ist der Ersatzleitwert gleich der Summe der Einzelleitwerte.
Quellen:
https://www.fluke.com/de-at/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-179
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/175_____umger0200.pdf
Fachkunde Elektrotechnik, 24. Auflage 2005, , Seite 47, Seite 48, Seite 51, Seite 52 Seite 164, Seite 165
Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co KG, 42781 Haan-Gruiten
https://esdifferent.com/difference-between-analog-and-digital-multimeter
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/ajw/Onlinelehrgang/a16/Bild16-14.gif