Wie stehen sich Nennleistung und Impedanz gegenüber?
Ich habe jetzt eine Anleitung zum alten SABA Hifi Studio 8080 aufgetrieben (PDF).
Da steht drin, dass man von 4 bis 16 Ohm anschließen kann.(Interessant) Weiter steht da noch, dass man bei 4 Ohm die Nennleistung hat und bei 16 ein Drittel davon.
Aber was heißt das genau?
Wie hängen Impedanz und Nennleistung zusammen?
4 Antworten

Bei einer rein ohmschen Last und konstanter Spannung würde eine Vervierfachung des Widerstands die Leistung auf 1/4 senken.
P = U² / R ( P Leistung, U Spannung, R Widerstand )
Da bei einer bestimmten Musikverstärker-Konstruktion und dem frequenzabhängigen Widerstand der Boxen die Abhängigkeit aber nicht mehr linear ist ( Kennlinien), sollte der Hersteller für seinen Verstärker den Zusammenhang am Besten kennen. Wenn er dir dazu also eine Angabe macht, dann wird es so sein.
Wenn deine Frage auf die "Lautstärke" abzielt, ob 1/3 Leistung nur ein Drittel Lautstärke bedeuten: Nein, "Lautstärke" ist ein komplexes Feld.
Rein mathematisch sind es dem Schalldruck nach noch um die 75 %
Bei Interesse kannst du mal hier anfangen zu lesen: https://www.musiker-board.de/threads/lautstaerkefaktoren-von-amps.55777/


Der Aufdruck auf Verstärkern - oft 4-8 Ohm - ist eine Empfehlung für die optimale Anpassung zwischen Lautsprecher und Verstärker.
Die Impedanz zeigt aber eher die minimale Impedanz an, denn ein Lautsprecher hat über das gesamte Frequenzspektrum verschiedene Impedanzen. So kann die Impedanz im Bassbereich im Bereich der Resonanzfrequenz der Membran über 100 Ohm betragen. Wichtig ist aber die Impedanzsenke im Grundton, die wie eine Wanne ausgeformt ist, der Wannenboden liegt dann z. B. bei 4 Ohm oder 8 Ohm.
Ein Verstärker liefert Strom. Umso geringer der diesem Strom entgegengesetzte Widerstand, desto mehr Strom fließt. Das lässt aber das Netzteil und die Transistoren überhitzen. Nehmen wir an, die minimale Impedanz wäre 0 Ohm, das entspräche einem Kurzschluss zwischen Minus und Plus des Lautsprecheranschlusses und die Elektronik verraucht.
4 Ohm Minimum bedeutet, dass das der Verstärker noch schafft, ohne zu überhitzen. Bei älteren Modellen kann das auch mal 8 Ohm sein, bei AV-Receivern oft 6 Ohm.
Ein Lautsprecher mit der Bezeichnung 4-8 Ohm hat im Minimum 4 Ohm. Leider ist das sehr missverständlich ausgedrückt. Die 4-8 Ohm sind eher eine Verstärkerempfehlung.
Rein rechnerisch: Halbierst du den Widerstand, verdoppelt sich die Leistung. Halbierst du den Widerstand nochmal, vervierfacht sich der Stromfluss. Und nochmal halbiert, fließt der achtfache Strom... Also, hast du eine 8-Ohm-Box, fließen z. B. 50 W. Bei 4 Ohm schon 100, bei 2 Ohm 200 etc.
Mit einem handelsüblichen Home-HiFi-Verstärker übrigens unerheblich. Bei gehobener Zimmerlautstärke, wo man sich nicht mehr normal unterhalten kann, fließen nur wenige Watt. Je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher. Da kann man auch mit geringer Unterschreitung der Minimalimpedanz nichts kaputt machen. Aber es ist nicht zu empfehlen!
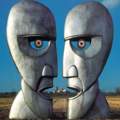

Hallo darkhouse,
deine gute Antwort hat leider ein paar ungenaue Erklärungen, auf die ich gerne eingehen möchte.
Du sprichst von:
Der Aufdruck auf Verstärkern - oft 4-8 Ohm - ist eine Empfehlung für die optimale Anpassung zwischen Lautsprecher und Verstärker.
Es geht aber nicht um Anpassung (darauf gehe ich später noch genauer ein), sondern nur um den Schutz des Verstärkers durch Überlastung, damit durch eine Lastimpedanz kleiner 4 Ohm nicht zu viel Strom aus dem Verstärker entnommen wird, als er liefern kann.
Dann erklärst du folgendes:
Ein Verstärker liefert Strom. Umso geringer der diesem Strom entgegengesetzte Widerstand, desto mehr Strom fließt
Das ist so nicht richtig. Der Verstärker produziert eine Spannung, die dann den Strom durch die Last treibt.
Verringerst du die Ausgangsspannung auf Null Volt, kannst du den Ausgang sogar mit Lastwiderständen in Richtung Null Ohm belasten und es wird kein Strom fließen.
Deshalb stimmt auch diese Behauptung nicht:
Nehmen wir an, die minimale Impedanz wäre 0 Ohm, das entspräche einem Kurzschluss zwischen Minus und Plus des Lautsprecheranschlusses und die Elektronik verraucht.
Sie verraucht nur, wenn auch eine Tonfrequenz-Wechselspannung als Ausgangsspannung vorhanden ist.
Du beschreibst vollkommen richtig, dass bei Halbierung des Lastwiderstandes der doppelte Strom fließt usw, erklärst dann aber:
Also, hast du eine 8-Ohm-Box, fließen z. B. 50 W.
Es fließt keine Leistung, Leistung wird in der Last abgegeben bzw entsteht im Lastwiderstand durch den fließenden Strom und die Arbeit, die er verrichtet. Leistung also als Umwandlung von elektrischer Energie in Bewegungsenergie und Wärmeenergie.
Wikipedia definiert Leistung so:
Die physikalische Größe Leistung ist die in einer Zeitspanne umgesetzte Energie bezogen auf diese Zeitspanne
und
Bei Gleichstrom ist die tatsächliche elektrische Leistung P das Produkt der elektrischen Spannung U und der elektrischen Stromstärke I , also kurz: P = U * I
und
Verhält sich der Verbraucher als ohmscher Widerstand R, lässt sich die Leistung durch Anwendung des ohmschen Gesetzes U = R ⋅ I ausdrücken durch P = I^2 * R bzw. P = U^2/R
Der Artikel "Leistungsanpassung" bei Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
erklärt viele Zusammenhänge (leider auf höherem Niveau), interessant und für jeden verständlich ist jedenfalls der letzte Absatz vor Weblinks, beginnend mit "In der Tontechnik und im HiFi-Bereich":
Es wird in modernen Transistor-Endstufen ohne Ausgangs-übertrager immer eine Spannungsanpassung verwendet mit folgenden Merkmalen:
- der Ausgangswiderstand des Verstärkers ist extrem niedrig und liegt in etwa im Bereich um 0,1 Ohm, wobei ein niedriger Wert besser ist als ein höherer.
- Der minimale Abstand zwischen diesem niedrigen Ausgangswiderstand und dem angeschlosenen Lastwiderstand (Impedanz des Lautsprechers) sollte mindestens 1/10 sein, besser ist ein grösserer Abstand.
- Insbesondere Audioendstufen sollen einen geringen Ausgangswiderstand haben, weil dadurch die Eigenresonanzen des Lautsprechers besser gedämpft werden.
Der Dämpfungsfaktor einer Endstufe sollte demnach so groß wie möglich sein.
Fairaudio hat eine gute und verständliche Erklärung:
http://www.fairaudio.de/lexikon/daempfungsfaktor/
Hie noch ein schönes, einfaches Beispiel anhand eines Wasser-Modells, wie Spannung, Strom und Widerstand zusammenhängen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gefunden habe, es lautet ungefähr so:
- Nimm einen Eimer mit Wasser und stell Ihn oben auf einen Schrank. Dadurch , das Du den Eimer gegen die Erdanziehung hochgehoben hast, hast du das Energieniveau erhöht, denn du hast Arbeit verrichtet und hast damit Spannung produziert.
- Lässt Du jetzt das Wasser durch verschieden dicke Schläuche in ein tiefer liegendes Becken laufen, wirst du feststellen, dass bei einem dünnen Schlauch nur eine geringe Menge Wasser fließt, durch einen dicken Schlauch aber viel mehr.
- Der Grund ist der unterschiedliche Fließwiderstand im dünnen und dicken Schlauch bei gleichbleibender Kraft, die das Wasser antreibt.
- Bei dünnen Schläuchen hat das Wasser einen größeren Widerstand zu überwinden und der Fluss ist geringer .
- Bei dickeren Schläuche ist der Widerstand für das Wasser geringer und der Fluss ist größer .
- Die Antreibende Kraft ist die Erdanziehung und die gespeicherte Energie beim emporheben (wie bei einem Pumpspeicherwerk), das entspricht der elektrischen Spannung.Schläuche = Widerstand ( R )Fluss = Strom in Ampere ( I )Hoch gehobener Eimer mit Wasser = Spannung ( U )
Das ist der erste Teil meines Kommentars, der letzte Teil kommt anschließend
Grüsse, Dalko

Quatsch, sauer, solange ich im allgemeinen Sprachgebrauch den Inhalt hilfreich rüberkriege - und so daneben liege ich ja nun nicht - ist das gut. Wenn noch jemand mit astreiner elektrische Bildung was perfektioniert oder ergänzt, ist mir das mehr als recht. Danke!

Hallo isfarmer,
leider stimmt nicht alles, was dir in den Antworten beschrieben wurde, denn die Abhängigkeiten zwischen Spannung, Strom, Widerstand (Impedanz) sind manchmal nicht ganz korrekt dargestellt.
Ich habe diese Zusammenhänge in meiner Antwort auf diese Frage
https://www.gutefrage.net/frage/geht-der-verstaerker-kaputt-wenn-man-einen-8-ohm-lautsprecher-an-einen-6-ohm-verstaerker-anschliesst?foundIn=list-answers-by-user#answer-250831352
ausführlich und in sehr simplen Vergleichen gut verständlich beschrieben, damit auch jemand, der von Physik und Elektrotechnik wenig Ahnung hat, die Zusammenhänge trotzdem gut verstehen kann.
Deine Frage ist etwas anders gestellt, denn du willst den Zusammenhang zwischen Impedanz und Nennleistung wissen. Deshalb erkläre ich den Zusammenhang zwischen (Nenn-) Leistung einer Endstufe, der Impedanz eines Lautsprechers, dem fließenden Strom durch den Lautsprecher und der Höhe der Tonfrequenz-Ausgangsspannung der Endstufe.
Die Elektrische Leistung lässt sich auf unterschiedliche Art beschreiben:
Die Leistung P ist das Produkt von Stromstärke und Spannung: P = U * I
Außerdem gilt folgender Zusammenhang zwischen der Leistung P und der Spannung U, die an einem Widerstand anliegt:
Die Leistung P errechnet sich aus dem Quadrat der Spannung, die am Widerstand anliegt, geteilt durch den Wert des Widerstandes, also:
P = U^2 / R
Aus meiner anderen Antwort und den oben beschriebenen Abhängigkeiten kannst du folgendes Erkennen:
Die Leistung entsteht im Lastwiderstand, durch den ein bestimmter Strom fließt. Der Strom fließt nur aus folgenden Gründen:
- Durch die Höhe der am Widerstand anstehenden Spannung und
- durch den Wert des Widerstandes.
Der Einfachheit halber beschreibe ich die Zusammenhänge so, als wenn es sich um Gleichspannung, Gleichstrom und einem ohmschen Gleichstrom-Widerstand handelt, obwohl es in Wirklichkeit um eine (Tonfrequenz-) Wechselspannung, Wechselstrom und Impedanz (frequenzabhängiger Wechselstromwiderstand) bei Endstufe und Lautsprecher handelt.
Liefert also die Endstufe eine maximale Tonfrequenzwechselspannung von 60 Volt und der Lastwiderstand beträgt 8 Ohm, fließt ein Strom von 60V/8Ohm = 7,5 A. Die abgegebene Leistung beträgt:
P = U * I = 60V * 7,5 A = 450 Watt
Bei einem Lastwiderstand von Unendlich, das entspricht einem offenen Ausgang, es sind also keine Lautsprecher angeschlossen, fließt kein Strom, aber die maximale Ausgangsspannung ist selbstverständlich vorhanden.
Es sind also immer Spannung und Widerstand, die den Stromfluss bestimmen. Die Auslegung des Netzteils und der Endstufentransistoren muss in der Lage sein, diesen Strom zu liefern.
Wenn nun eine Endstufe so konstruiert wurde, dass sie eine maximale Tonfrequenzwechselspannung von 60 V erzeugen kann, das Netzteil aber nur maximal 4 A Strom, lässt sich daraus bestimmen, welchen Wert der Lastwiderstand haben darf, damit nicht zu viel Strom aus der Endstufe "gezogen" wird, also R = U/I = 60V/4A = 15 Ohm.
Diese Endstufe muss also gekennzeichnet werden mit dem Aufdruck:
Minimale Anschlussimpedanz des Lautsprechers nicht unter 15 Ohm
Die Leistung, die dabei abgegeben und im Widerstand in Wärme umgewandelt wird, beträgt also:
P = U^2 / R = 60V im Quadrat dividiert durch 15 Ohm = 240 Watt.
Soll diese Endstufe auch mit Lastwiderständen von 8 Ohm oder 4 Ohm betrieben werden können, hast du als Konstrukteur nur 2 Möglichkeiten:
- Du erhöhst die Stromlieferfähigkeit des Netzteils und passt auch die Endstufe so an, dass höher belastbare Transistoren verwendet werden, die diese höheren Ströme verarbeiten können.
- oder du verringerst die maximale Tonfrequenzwechselspannung, die die Endstufe erzeugen kann, ohne die Amplituden zu beschneiden (Clipping), auf so niedrige Werte, dass der maximale Strom von 4 A nicht überschritten werden kann (normalerweise durch Verringerung der im Netzteil produzierten Gleichspannung zur Versorgung der Endstufe), also:U = R x I = 8 Ohm x 4 A = 32 V oder bei 4 Ohm Lastwiderstand nur noch 16 V. Dementsprechend verringert sich die maximale Ausgangsleistung auf 122 Watt oder 64 Watt
Du siehst, dass du demnach die Möglichkeit hast, bei einer gewünschten Leistungsabgabe von 100 Watt (Nennleistung) an einer Lautsprecher-Impedanz von 4 Ohm eine Tonfrequenzwechselspannung von
U = Wurzel aus (P * R) = 20 V zu erzeugen
oder bei 8 Ohm eine Spannung von 28,28 V
Wenn du aber eine Endstufe so baust, dass sie die notwendige Spannung erzeugt, um den erforderlichen Strom durch eine Last von 8 Ohm fließen zu lassen, um 100 Watt Leistung zu erzeugen, und vermeiden willst, dass durch eine Last von 4 Ohm die Endstufe überlastet wird und sich die Endstufentransisitoren oder / und das Netzteil zu stark erwärmen und alles abraucht, wirst du bei diesem Verstärker auf die Rückseite neben den Anschlussterminals für die Lautsprecher den Aufdruck platzieren müssen:
Erlaubte Lautsprecher-Impedanz: 8 bis 16 Ohm.
Wenn du dennoch 4 Ohm Lautsprecher anschließen möchtest, musst du dafür sorgen, dass die Endstufe nur soweit ausgesteuert wird, dass die Spannung, die 4 A fließen lässt, am Verstärker-Ausgang nicht überschritten wird.
Wenn du zum Beispiel ein Oszilloskop besitzen würdest, könntest du damit die Höhe der Tonfrequenzwechselspannung sichtbar machen und den Verstärker präzise Aussteuern, ohne eine Überlastung zu erzeugen.
Noch ein Hinweis zur Lautstärke oder besser zum Schalldruck. Wenn du eine bestimmte gehörte Lautstärke/Schalldruck verdoppeln möchtest, benötigst du nicht die doppelte Verstärkerleistung, sondern die 10-fache!!!
Deshalb ist es ziemlich sinnlos, sich über Leistungsunterschiede im 10 bis 20%-Bereich zu streiten, denn der erzielbare Schalldruckunterschied ist minimal.
Abschließend zur Impedanz eines Lautsprechers:
Sie verändert sich je nach Frequenz, darf aber bei einem 4 (8, 16) Ohm Lautsprecher diese 4 (8, 16) Ohm an keiner Stelle der Impedanzkurve unterschreiten.
Nach oben können aber Bereiche im Impedanzverlauf mit einem vielfachen von 4 (8, 16) Ohm zu sehen sein.
http://www.shuredistribution.de/support_download/fachwissen/lautsprecher/lautsprecher-basiswissen
http://tonthemen.de/viewtopic.php?t=1602
Ich hoffe, dass ich verständlich geblieben bin... und dass mir kein Fehler unterlaufen ist, denn es ist sehr spät und mein Hirn schon ziemlich träge. Bei Fragen bitte melden.
Grüße, Dalko

bei anderen Anlagen wie bei Beschallungsboxen kann man bei 4 Ohm Impedanz des Amps & mit 16 Ohm Boxen dann auch 4 Boxen in Reihe schalten pro Seite, ohne daß der Amp in die Knie geht
http://www.seeburg.net/de/lautsprecher/l-serie/34
Bei diesem Säulensystem gibt es sogar 64 Ohm Versionen, um seriell die Box zur Box weiterzuschleifen
Die Leistung bleibt dabei gleich beim Amp

Nicht ganz richtig - du sprichst von Lautsprechersystemen die parallel geschaltet werden.
In Reihe würden sich die Widerstände (Impedanzen) addieren ;-)
Und hier der letzte Teil meines Kommentars:
Abschließend möchte ich noch auf Audio-Verstärker eingehen, die ja Tonfrequenz-Wechselspannung verstärken sollen und die entsprechenden elektrischen Wechsel-Größen etwas beschreiben, aber nicht ausführlich, Erklärung weiter unten.
Ein guter Artikel von Shure, frei von nervender höherer Mathematik:
http://www.shuredistribution.de/support_download/fachwissen/verstaerker/verstaerker-basiswissen
Bei Wechselstrom sind die Größen Spannung u und Stromstärke i von der Zeit t abhängig.
Es handelt sich ja bei der Musik um ein komplexes Gemisch unterschiedlicher Sinusschwingungen, die der Verstärker verarbeitet, und jede Sinusschwingung verändert sich innerhalb der Zeit, die eine Sinusschwingung benötigt.
Sie beginnt bei Null Volt gefolgt von einem positiven Maximum, einem Nulldurchgang, einem negativen Maximum und einem erneuten Nulldurchgang und die dabei benötigte Zeit hängt ab von der Frequenz der einzelnen Sinusschwingung.
Hier sind mehrere Leistungsbegriffe zu unterscheiden:
Und an dieser Stelle steige ich aus, weil die Mathematik viele Leser überfordert, deshalb habe ich auch die ganze Problematik bisher mit dem noch leicht verständlichen Erklärungs-Modell von Gleichspannung, Gleichstrom und ohmschen Widerstand erläutert (was aber nicht korrekt ist, aber durchaus zur Erklärung grundsätzlicher Zusammenhänge verwendet werden kann) und möchte es auch dabei belassen, Interessierte können bei Wikipedia weiter lesen, um korrekte Erklärungen zu bekommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
oder auch bei Sengpiel:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-VerstaerkerLautsprecherUndOhm.htm
Ich hoffe, du bist nicht sauer wegen meines Kommentars, aber wie du selber genau weißt, sind Fragen zu Verstärkerleistung, Belastbarkeit von Lautsprechern, deren Impedanz, Anpassung, Wirkungsgrad.... und wie alles voneinander abhängt, wirklich kompliziert und man benötigt einige Jahre, alles genau zu verstehen...auch ich lerne heute noch dazu.
Grüße, Dalko