Haben oder Sein-Hausaufgabe?
Hilfe! Ich verstehe diese Hausaufgabe nicht. Könnt ihr mir helfen und sie für mich machen?
2 Antworten
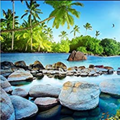
Haben oder Sein (Untertitel: Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft) ist ein populäres gesellschaftskritisches Werk des Sozialpsychologen Erich Fromm aus dem Jahr 1976. Es zählt mit Die Kunst des Liebens aus dem Jahr 1956 zu seinen bekanntesten Werken.
Haben oder Sein in der PraxisAm Ende seines Werkes arbeitet Fromm Gemeinsamkeiten derjenigen Denkweisen heraus, die sich vom Gedanken des Habens gelöst haben und sich der Sicht des Seins verpflichtet fühlen. Dieser Geist des Seins zeichnet sich durch folgende Punkte aus:
- die Arbeit habe der Erfüllung der wahren Bedürfnisse des Menschen und nicht den Erfordernissen der Wirtschaft zu dienen
- das Verhältnis der Ausbeutung der Natur durch den Menschen wird durch das der Kooperation zwischen Mensch und Natur ersetzt
- der wechselseitige Antagonismus zwischen den Menschen ist durch Solidarität ersetzt
- oberste Ziele des gesellschaftlichen Arrangements seien das menschliche Wohlsein und die Verhinderung menschlichen Leids
- maximaler Konsum ist durch einen vernünftigen Konsum (Konsum zum Wohle des Menschen) ersetzt
- der einzelne Mensch wird zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben motiviert
Denker, bei denen Fromm diese geistige Grundhaltung erkennt, sind u. a. Thoreau, Emerson, Albert Schweitzer, Ernst Bloch, Ivan Illich, die jugoslawischen Schriftsteller um die Zeitschrift Praxis, Ernst Friedrich Schumacher, Erhard Eppler.
Gemeinschaften, in denen dieser Geist gelebt wird, seien u. a. die israelischen Kibbuzim, die hutterischen Gemeinden, die Communautées de Travail.
Fromm skizziert eine Gesellschaft, in der Menschen in sogenannten Nachbarschaftsgruppen zusammenleben und ein „Oberster Kulturrat“ Medien, Forschung und Entwicklung so neutral wie möglich kontrolliert. Dieser Aufsichtsrat sollte sich nach Fromms Empfehlung aus „Männern und Frauen, deren Integrität über jeden Zweifel erhaben ist“[5], zusammensetzen. Ziel davon soll zum Beispiel sein, dass dadurch „Profit und militärische Nutzbarkeit“[6] in der wissenschaftlichen Forschung minimiert werden.
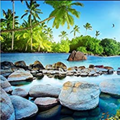
Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe..
Dieser Gedanke Erich Fromms schwirrt schon sehr lange in meinem Kopf herum.
Als ich vor einiger Zeit mit einem Freund ein Gespräch führte und dieser mir erklärte, dass er doch eigentlich ein sehr glücklicher Mensch sei - schließlich HABE er einen Arbeitsplatz, eine gesellschaftliche Stellung, eine harmonische Beziehung und andere materielle Güter - warf ich ihm im ersten Moment einen zweifelnden Blick zu.
Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe, und dann verliere, was ich habe? Ist das nicht Zeugnis einer falschen Lebensweise? Wenn ich verlieren kann, was ich HABE? Autos, Reisen, Sex, Fernsehen, Besitzstreben, Erwerb, Profitstreben, Eigentum, Macht, Mentalität der Egozentrik, Selbstsucht, Gier, Eifersucht, Rivalität, Furcht, Habgier, Kampf, Illusionen, Haß und Neid bestimmen das Leben. Fürchtet sich der Mensch nicht ständig vor wirtschaftlichen Veränderungen, vor Revolutionen, vor Krankheit, vor dem Tod, ja sogar zu lieben, Angst vor der Freiheit, vor dem Wachsen, vor der Veränderung, vor dem Unbekannten? Muss das nicht ein erbarmenswertes Leben sein? Hinsichtlich jeglichen Verlustes in ständiger Sorge zu leben? Doch wie schütze ich mich vor solch einer Lebensweise? Soll ich defensiv sein? Hart? Misstrauisch? Immer vor den Augen das Ziel von "mehr" zu haben? Wohl kaum, denn gerade dieses Verhalten ist der Angst förderlich.
Ich bin, was ich habe. Folglich sollte man sein, der man ist und nicht, was man hat, denn so kann mich niemand berauben, meine Sicherheit oder mein Identitätsgefühl bedrohen. Doch wie schafft man es bloß, mit dieser Existenzweise eins zu werden? Was anfangs vielleicht einfach erscheinen mag, stellt sich mir in weiterer Folge als schier unmöglich dar. Verleitet solch ein Denken nicht zu extremem Egoismus? Oder sogar zu "exzentrischem Narzissmus"? Versteckt sich nicht allzu oft hinter einer glänzenden Fassade eine gebrochene, verlorene Gestalt? Gefangen in sich selbst? Und ist nicht die Krönung dieses armseeligen Daseins, sich seiner Verlorenheit bewusst zu sein und keinen Weg aus der Leere zu wissen?
Die Bedrohung dieser "wahren" Lebensweise liegt einzig und allein in einem selbst. Als sehr positiv kann sich dies herausstellen, schließlich kann einem keiner mehr etwas wegnehmen, keiner kann über einen bestimmen. Doch umso zerstörerischer diese Eigenschaft, wenn man es nicht schafft, zu sein, der man ist. Was ist, wenn man in seinem Leben immer und immer wieder die Erfahrung des "Verlierens" erlebt? Wie kann man dann von dieser Angst bloß loskommen?
Während sich in der falschen Lebensweise das, was man hat, durch Gebrauch verringert, nimmt die richtige Lebensweise durch die Ausübung, durch die Praxis, zu. Die Kraft der Vernunft, der Liebe, des künstlerischen und intellektuellen Schaffens - all dies wächst, indem man es ausübt. Was man gibt, verliert man nicht, sondern im Gegenteil, man verliert, was man festhält. dieNamenlose

Soll ich mal raten?
Die Verben der Bewegung werden in den Vollendeten Zeiten mit sein konjugiert, alle anderen mit haben.
ich bin gegangen
ich habe geholt